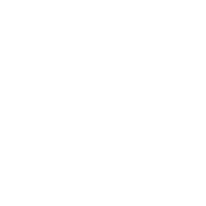Die ‘Zukunft der Arbeit’ wird zunehmend komplexer. Die Anzahl der Dinge, die sich verändern, ist für sich allein ein ganzes Studium wert. Darum ist es wichtig, dass wir die Gemeinsamkeiten in diesen Dingen erkennen. Somit können wir einem Schritt mehrere Themen. Digitalisierung und Sozialisierung zur Globalisierung sind zwei solcher Themen, die eng miteinander verbunden sind. In beiden Fällen geht es um das Zerlegen komplexer Systeme in ihre Tausende von Einzelteilen, die Auswahl der relevanten Teile und die selbstverantwortliche Gestaltung neuer Systeme.
Digitalisierung und Globalisierung haben Vieles gemeinsam
Zum Einen lassen sie sich genauso wenig wegdiskutieren wie die Erdanziehungskraft (Kofi Annan), zum Anderen haben die meisten von uns eine Sozialisierung erfahren, die nach äußerer Stabilität, Verlässlichkeit und Eindeutigkeit verlangt. Fallen diese äußeren Strukturen plötzlich weg, erleben wir ein solches Ereignis als potentielle Bedrohung und reagieren mit den üblichen Stresssymptomen. Das ist als einmaliges Ereignis durchaus zumutbar, ist langfristig gesehen aber eine gesundheitlich unhaltbare Situation.
Sozial oder Solitär
Verhaltensforscher unterscheiden zwischen sozialen und solitären Tierarten. Soziale Tierarten leben in Gruppenbeziehungen, die über die Mutter-Kind Beziehung hinausgehen. Die Größe solcher Gruppen kann ein Dutzend Individuen umfassen oder über Hunderttausend. Solitäre Tierarten gehen keine Bindungen mit anderen Individuen ein, die über Kopulation oder Aufzucht von Jungtieren hinausgeht.
Aggressionshemmende Mechanismen
Jedes Individuum vom Bakterium über die Pflanzen bis zu den Tieren besitzt eine innere Aggression. Damit ist gemeint, dass Individuen sich nach außen hin abgrenzen und diese äußere Grenze anderen gegenüber signalisieren. Die einen Arten tun dies chemisch (Bakterien, Pflanzen und viele Insekten) und andere Arten tun dies visuell, phonetisch oder taktil. Sowohl soziale wie auch solitäre Arten müssen in der Lage sein diese innere Aggression zumindest zeitweise zu überwinden. Solitäre Arten nur kurzfristig aber soziale Arten mehr oder weniger ständig.
Die dazu angewandten Methoden werden als aggressionshemmende Mechanismen bezeichnet. Welche Form der Aggressionshemmung eine Art entwickelt ist eng verbunden mit der Form, mit der die Individuen dieser Art sich voneinander abgrenzen.
Bienen und Ameisen grenzen sich über den Geruch von einander ab verwenden den Geruch der Gruppe aber als aggressionshemmenden Mechanismus. „Wer so riecht wie ich ist Freund. Wer anders riecht ist Feind.“ Mit diesem simplen Prinzip schaffen es beide Arten in Gruppen von Tausenden von Individuen zusammenzuleben. Der Mensch dagegen arbeitet mit verhaltensbiologischen Mechanismen. Wir senden einerseits abgrenzende Signale aus und verwenden andererseits Signale mit denen wir unserer Umwelt signalisieren, dass wir nicht gefährlich sind oder sogar eine Annäherung wünschen.
Angeboren oder Erlernt
Einige wenige Mechanismen sind uns angeboren. Dazu gehören das Bedürfnis nach Begrüßung, die Fähigkeit zu Lächeln und das verärgerte Stirnrunzeln. Egal in welchem Kulturkreis wir aufgewachsen sind, diese aggressionshemmenden Mechanismen sind bei allen Menschen gleich. Die meisten unserer Mechanismen sind jedoch angelernt. Während das Bedürfnis nach Begrüßung angeboren ist, ist die Form der Begrüßung angelernt. Wichtig ist nur, dass der Sender des Signals eine Begrüßung wählt, die der Empfänger als Begrüßung versteht. Ist das nicht der Fall findet die Hemmung der natürlichen Aggression nicht statt und der Empfänger fühlt sich unter Umständen bedroht.
Starke und schwache aggressionshemmende Mechanismen
Verhaltensbiologen sprechen von starken aggressionshemmenden Mechanismen und von schwachen. Die Stärke wird an ihrer Wirksamkeit gemessen. Danach ist das Geruchsprinzip der Bienen und Ameisen ein starker Mechanismus, weil er ihnen erlaubt in sehr großen Gruppen zusammenzuleben. Die Mechanismen des Menschen sind sogar in der Summe verhältnismäßig schwach, weil wir schon bei ca. 80 Individuen unsere obere Grenze erreichen. Alles was darüber hinausgeht löst in uns Flucht- oder Angriffsreaktionen aus. Da wir dazu erzogen werden diese Gefühle zu unterdrücken, entsteht ein Dauerstress, dessen gesundheitliche Auswirkungen ausführlich erforscht worden sind.
Wir denken in Kategorien
Ganz klar, in unserer heutigen Welt ist eine Obergrenze von 80 Individuen in unserem Umfeld nicht ausreichend. Schon auf dem Weg ins Büro oder in die Schule begegnen die meisten von uns weit mehr als 80 anderen Menschen. Wir müssten also theoretisch immer gleich nach dem Schulweg oder dem Weg ins Büro wieder nachhause ins Bett. Weil das nicht geht, haben wir die Fähigkeit entwickelt, in Kategorien zu denken. D.h. wir betrachten 10-20 Menschen als Individuen und ersetzen die übrigen 60-70 durch Kategorien. Diese Kategorien können physikalischer Natur sein (groß/klein, dick/dünn, hell/dunkel, weiß/gelb/rot/braun/schwarz) oder verhaltensbedingt (Begrüßung durch Händeschütteln/Verbeugung/Augenaufschlag/Nasereiben).
Grenzüberschreitungen
Die Wahrnehmung von Kategorien ist erst dann keine Stärke mehr, wenn wir beginnen zwischen guten und weniger guten Kategorien zu unterscheiden. Dann kommt es zu …ismen wie Rassismus, Sexismus, Ageismus, etc. und aus der potentiellen Stärke wird eine gefährliche Schwäche, die uns in unseren sozialen Fähigkeiten einschränkt, in dem sie unsere bereits schwachen aggressionshemmenden Mechanismen weiter aushebelt.
Leider haben wir über den Umweg von monotheistischen Religionen monokulturelle Gesellschaften entwickelt, die klar zwischen richtig und falsch, gut und böse unterscheiden. Wer die Grenzen der ihm zugeordneten Kategorien überschreitet, wird mit der uns angeborenen Aggression ausgegrenzt. Diese teils sehr massive Ausgrenzung wird von den Betroffenen als Bedrohung empfunden und entweder mit Flucht oder Angriff beantwortet.
Soziale Kompetenzen
Innerhalb der Gruppe ‚Mensch’ unterscheiden wir zwischen Menschen mit hoher oder niedriger Sozialkompetenz. Menschen mit hoher Sozialkompetenz können mit Grenzüberschreitungen spielerisch umgehen – sowohl mit ihren eigenen als auch mit denen ihrer Mitmenschen. Das Erschrecken bei dem Ausfall eines aggressionshemmenden Mechanismus löst bei diesen Menschen nicht Angst oder Wut aus, sondern lediglich ein Lachen, das Energie erzeugt statt sie zu verbrauchen. Wir verbinden daher mit dem Begriff einer hohen Sozialkompetenz ein positives Bild. Niedrige soziale Kompetenzen haben dagegen die Menschen, deren aggressionshemmende Mechanismen niedrig sind, d.h. sie reagieren entweder selbst schnell mit Aggression oder lösen bei anderen leicht Aggressionen aus.
Erziehung oder Schulung
Die erste Phase in der Entwicklung sozialer Kompetenzen ist die Kindheit. Kinder sind zunächst einmal offen für alles, werden dann aber entweder durch klare Zuordnungen von richtig/falsch oder gut/böse eingeschränkt oder aber aufgefordert zu beobachten, in jeder Situation neu zu entscheiden, und Verständnis für sich und andere zu entwickeln. Die Zuordnung zu Kategorien ist dann flexibel und es wird in jedem Moment zwischen passend/unpassend oder erfolgreich/fehlerhaft unterschieden. Im Laufe des Lebens kann der Mensch seine sozialen Kompetenzen erweitern oder sie verlieren. Erweiterung kann durch gezielte Schulung erreicht werden. Verluste entstehen meistens durch psychische Traumata. Beide sind miteinander verbunden: psychische Traumata können mit Hilfe von Schulung verhindert, verringert oder behandelt werden.
‚cross-culture individuals’
Seit Anfang der 60er Jahre wissen wir, dass es manchen Kindern gelingt aus zwei unterschiedlichen Kulturen ein persönliches Mosaik zu gestalten. Diese Menschen gehen nicht zwischen den Kulturen verloren, sondern fühlen sich beiden Kulturen 100% zugehörig.
Die Wissenschaft hat diese Kompetenz zunächst als ‚third-culture kids’ (TCK) bezeichnet, weil man zunächst meinte nur Kindern stünde dieser Weg offen und als Forschungsmaterial standen Kinder mit mehr als zwei Kulturen in ihrem Hintergrund nicht zur Verfügung. Seit man jedoch weiß, dass auch Erwachsene diese Kompetenz entwickeln können und weit mehr zwei Kulturen zur Gestaltung eines persönlichen Mosaiks herangezogen werden können, spricht man von ‚cross-culture individuals’ (CCI).
Gezielte Schulung zum ‚cross-culture individual’
Die unvorbereitete Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen kann traumatisierende Konsequenzen haben. Der plötzliche Verlust des Bekannten kann je nach Schwere der Situation als höchst bedrohlich empfunden werden und zu dem mit Abwehr verbundenen Reaktionen führen. Aggressionshemmende Mechanismen greifen in solchen Situationen häufig nicht mehr und der Mensch zeigt Reaktionen, die er in einer für ihn normalen Situation nicht für möglich gehalten hätte.
Von Entwicklungshelfern, Blauhelmen und Kriseneinsatzkräften sind Gewaltausbrüche bekannt geworden, die man dem einzelnen Menschen nicht zugetraut hätte, und die im Gegensatz stehen zum Ziel ihres Einsatzes.
Zusätzlich ist die Schwierigkeit der Wiedereingliederung im Heimatland heute bekannt und wird häufig mit der Posttraumatischen Belastungsstörung in engen Zusammenhang gestellt. Um solchen Vorfällen, deren Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung und der Traumatisierung der Betroffenen vorzubeugen, werden diese Einsatzkräfte heute intensiv zum ‚cross-culture individual’ geschult bevor sie zum ersten Mal rausgeschickt werden. Diese Schulung verringert zum Einen die Wahrscheinlichkeit und die Intensität einer Traumatisierung, und erleichtert zum Anderen die eventuell benötigten Heilungsprozesse.
Kulturen sind keine homogene Masse
‚cross-culture individuals’ sehen Kategorien nicht als homogene Blöcke, sondern als eine Gruppe von Einzelteilen, die alle etwas gemeinsam haben. Die Kategorie ‚große Menschen’ bedeutet für sie nicht ‚größer als 2m’, ‚zu groß’ oder ‚gerade richtig’, sondern ‚1,70m, 1,71m, 1,72m, …. 2,10m’. In diesem Sinne sehen sie ihre Mitmenschen, die Welt und sich selbst ‚digital’ und können sich dadurch ihrer jeweiligen Umgebung anpassen ohne dabei in den 7 Säulen ihrer Resilienz erschüttert zu werden oder die Wirkung ihrer aggressionshemmenden Mechanismen zu verlieren. Sie sind darin geübt die Kategorien ihrer Umwelt und die ihrer eigenen Persönlichkeit in ihren Einzelteilen zu erkennen, diese frei zu durchmischen und kreativ in der jeweils am Besten angepassten Version neu zusammenzusetzen.
Digitalisierung
Die technischen Lernschritte, die notwendig sind, um ein digitales System zu verstehen und zu kontrollieren, sind erlernbar. Heutzutage werden schon Kindergartenkinder auf das Erlernen dieser Fähigkeiten vorbereitet. Mengenlehre, Tastendrücken, Manipulation von Bildschirmen, Videospiele und vieles mehr werden schon Kleinkindern zugänglich gemacht.
Schwieriger zu erlernen ist das Loslassen des Bedürfnisses nach Eindeutigkeit, Stabilität, allgemein gültigen Kategorien und der Sicherheit stabiler Prozesse. Wer in der Kindheit angehalten wurde alles Kreative dem Wunsch nach Zugehörigkeit zu opfern, der tut sich schwer damit mit einem Mal selbstständig bereits existierende Strukturen aufzulösen, und sei es auch nur gedanklich. Schon der gedankliche Versuch löst Angst aus.
In diesem Sinne stellen Globalisierung und Digitalisierung den Menschen vor ganz ähnliche Herausforderungen. In beiden Fällen tritt der Einzelne aus der Gruppe heraus, stellt Bestehendes in Frage, kreiert etwas vermeintlich Besseres, Gutes oder zumindest Neues. Er öffnet sich damit der als Risiko empfundenen Kritik des Teams, des Marktes oder der Vorgesetzten.
Auf das Arbeiten in einem solchen Spannungsfeld, egal ob global oder digital, muss man vorbereitet sein, um sich nicht bedroht zu fühlen und sich erfolgreich in einen Betrieb einbringen zu können. Die Schulung oder Erziehung zum ‚cross-culture individual’ vermittelt in beiden Fällen diese Form der Vorbereitung.
1769 mal gelesen